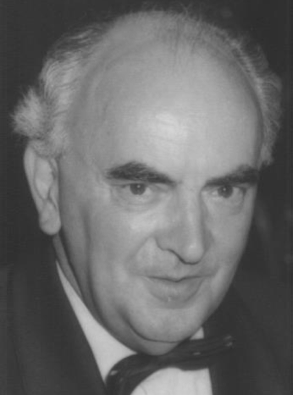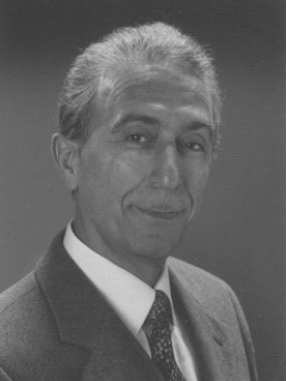Hartmut Collmann, Würzburg
Ulrike Eisenberg, Berlin
Die Grundlagen der modernen Chirurgie wurden seit der Mitte des 19. Jahrhunderts geschaffen, und mehrere Nationen haben dazu beigetragen: Die Narkose zur Ausschaltung des Operationsschmerzes wurde in den USA eingeführt (Warren 1846), die Antisepsis zur Vorbeugung der Wundinfektion in Schottland (Lister 1867). Die topische Organisation der Hirnfunktionen - Voraussetzung für gezielte Eingriffe am Gehirn - wurde in Deutschland (Fritsch & Hitzig 1871) und Schottland (Ferrier 1881) entdeckt.
Die Pioniere
In Deutschland waren es die zahlreichen militärischen Konflikte und die Wunden durch neue Distanzwaffen, die Chirurgen dazu zwangen, in das Gehirn vorzudringen, das bis dahin wegen der unvermeidlichen und meistens tödlichen Wundinfektion als tabu galt. Ernst von Bergmann (1836-1907), von vielen als Vater der modernen deutschen Chirurgie bezeichnet, war in erster Linie ein Militärchirurg. Geboren in Riga, Lettland, erwarb er seine ärztlichen Erfahrungen auf zahlreichen Kriegsschauplätzen, bevor er 1971 auf den chirurgischen Lehrstuhl in Dorpat (heute Tartu), Estland berufen wurde. 1878 wurde er Ordinarius an der Würzburger Universität, und 1882 schließlich Nachfolger Bernhard von Langenbecks an der Berliner Universitätsklinik. Er beschäftigte sich als erster Deutscher systematisch mit der Chirurgie des Gehirns. Frühzeitig übernahm er Listers Prinzip der Antisepsis, führte aber 1886 zusammen mit seinem genialen Mitarbeiter Curt Schimmelbusch (1860-1895) die Dampfsterilisation und damit das Prinzip der Asepsis ein. Ausgehend von seinen Erfahrungen als Militärarzt, wonach Hirnverletzungen häufig zu einem erhöhten Schädelinnendruck führen, untersuchte von Bergmann dieses Phänomen in seiner “Lehre von den Kopfverletzungen” (1880) genauer. Im Laufe der Zeit sammelte er auch Erfahrungen mit den nichttraumatischen Hirnerkrankungen, die er in dem Buch “Die chirurgische Behandlung der Hirnkrankheiten” (1889) zusammenfasste. Seine Haltung zur Tumorchirurgie war angesichts der katastrophalen Ergebnisse noch von großer Skepsis geprägt: Blutverlust und postoperative Hirnschwellung stellten unbeherrschbare Probleme dar. Nur rindennahe Tumoren des Großhirns hielt er für operabel, von Eingriffen am Kleinhirn riet er grundsätzlich ab. Seine Autorität sorgte dafür, dass der gerade aufkommende chirurgische Enthusiasmus wieder abebbte. Dennoch konnte sein Schüler Friedrich (“Fritz”) Gustav von Bramann (1854-1913), seit 1890 chirurgischer Ordinarius in Halle, über einige spektakuläre Erfolge bei Hirnoperationen berichten. Mit seinem „Balkenstich“, entwickelt zusammen mit seinem neurologischen Partner Gabriel Anton (1858-1933), stellte Bramann eine Verbindung zwischen drittem Ventrikel und äußeren Liquorräumen her und konnte mit dieser Frühform einer Ventrikulostomie beim Hydrozephalus vereinzelt sogar mehrjährige Behandlungserfolge erzielen.

Unabhängig von Ernst von Bergmann entwickelte sich Fedor Krause (1857-1937) zum eigentlichen Pionier der deutschen Neurochirurgie: Die Chirurgie des Nervensystems wurde sein Hauptarbeitsgebiet. Trotzdem blieb er zeitlebens Allgemeinchirurg, der das gesamte Spektrum der Chirurgie abdeckte. Krause hatte seine chirurgische Ausbildung bei Richard von Volkmann in Halle erhalten. Dort hatte er mit dem “Krause-Lappen” (Krause-Wolfe graft), einem freien Vollhauttransplantat, bereits einen bedeutenden Beitrag zur plastischen Chirurgie geleistet.
Nach seiner Habilitation wurde er 1892 zum Leiter der chirurgischen Abteilung in Hamburg-Altona berufen, wechselte aber 1900 nach Berlin an das kleine, gemeinnützige, privat getragene Augusta-Hospital, wo er bis zu seinem Ruhestand 1921 blieb.
Krause war ein außerordentlich begabter Chirurg, der als Erster einige der wichtigsten Zugangswege zu tief gelegenen Hirnregionen beschrieb. So entwickelte er 1893 kurz nach, aber unabhängig von dem Amerikaner Frank Hartley (1856-1813) den extraduralen Zugang zum Ganglion Gasseri bei Patienten mit Trigeminusneuralgie. Zur Schädelöffnung übernahm er Wilhelm Wagners (1848-1900) Technik des gestielten Knochenlappens von 1889, die sich damit als Routinemethode durchsetzte. 1898 beschrieb er den operativen Zugang zum Kleinhirnbrückenwinkel und 1900 den Zugang zur Sellaregion entlang der Basis des Stirnhirns, um eine Pistolenkugel zu entfernen. Das Projektil hatte er mit den von Wilhelm Conrad Röntgen 1895 entdeckten Strahlen lokalisieren können. Krause war 1908 vermutlich der erste Chirurg, der einen lumbalen Bandscheibenvorfall erfolgreich entfernte, auch wenn er ihn irrtümlich für einen Tumor („Enchondrom“) hielt. Schließlich entwickelte er 1913 den Zugang zur Pinealisregion zwischen Kleinhirnoberfläche und Tentorium, den „Krause-Zugang“. Da zu dieser Zeit neuroradiologische Kontrastverfahren noch nicht zur Verfügung standen, war Krause auf die subtile klinische Untersuchungstechnik seines genialen neurologischen Partners Hermann Oppenheim (1857-1919) angewiesen, der ihm zeigte, wo der Schädel oder der Wirbelkanal geöffnet werden musste. Hirnoperationen führte Krause stets zweizeitig durch, weil sich der Patient wegen der noch unzureichenden Methoden der Blutstillung und fehlenden Transfusionsmöglichkeit nach der Trepanation zunächst erholen musste. Der eigentliche Eingriff am Gehirn folgte eine bis zwei Wochen später. Trotz der bereits bekannten Risiken der Chloroform-Narkose zog er diese Form der Schmerzausschaltung der gut entwickelten Lokalanästhesie vor, da letztere den Patienten psychisch zu sehr belaste. Eingriffe am Kleinhirn führte er am sitzenden Patienten durch, wobei der Kopf durch einen Assistenten gestützt wurde. Seine neurochirurgischen Erfahrungen fasste Krause 1908 und 1911 in einem zweibändigen Lehrbuch zusammen, das auch in englischer und französischer Übersetzung erschien und über Jahrzehnte als Standardwerk galt.
Neben Krause begannen auch andere Chirurgen, sich auf das Nervensystem zu konzentrieren. Dem Bergmann-Schüler Moritz Borchardt (1868-1948) gelang 1905 erstmals die radikale Entfernung eines Tumors des achten Hirnnerven (Vestibularisschwannom), die nicht sofort im Tod des Patienten endete – bei der damals üblichen Präparationstechnik mit dem Finger ein kleines Wunder. Borchardt beschäftigte sich auch intensiv mit der Chirurgie peripherer Nerven und führte vorbildliche anatomische Studien durch. Als einer der ersten wies er auf die Bedeutung der Dauer der primären Bewusstlosigkeit für die Prognose gedeckter Hirnverletzungen hin. Der Österreicher Erwin Payr (1871-1946) in Leipzig behandelte den Wasserkopf (Hydrozephalus), indem er mit einer frei transplantierten Vene eine direkte Verbindung zwischen Hirnkammern und Längsblutleiter herstellte, eine Technik, die eine feine Gefäßnaht erforderte. Ernst Unger (1875-1938), ebenfalls Bergmann-Schüler, führte 1910 und damit lange vor Harvey Cushing den chirurgischen Sauger bei Hirnoperationen ein. Warum seine Entdeckung von seinen Kollegen nicht weiter beachtet wurde, ist bis heute ein Rätsel. Bekannter wurde Unger als Pionier der Nierentransplantation und des Blutspendewesens.
Die zweite Pioniergeneration
Der Erste Weltkrieg beeinflusste die Neurochirurgie in Deutschland nachhaltig, allerdings in gegensätzlicher Weise. Zunächst führten die zahlreichen Verwundeten von den Schlachtfeldern zu einem Entwicklungsschub: Viele Chirurgen befassten sich jetzt mit der Versorgung von Verletzungen peripherer Nerven und des Gehirns. In Berlin gab es ein erstes Spezial-Lazarett für Hirnverletzte. Mit der Niederlage der deutschen Wehrmacht wurde diese aus medizinischer Sicht positive Entwicklung abrupt gebremst. Die Siegermächte schlossen Deutschland vom internationalen wissenschaftlichen Austausch weitgehend aus und verbannten die deutsche Sprache aus internationalen Journalen. Begründet wurde dieser Boykott nicht allein mit der Deutschland aufgebürdeten Kriegsschuld, sondern explizit mit dem aggressiven deutschen Nationalismus, wie er besonders in der Erklärung „An die Kulturwelt“ vom Oktober 1914 zum Ausdruck kam. Obwohl der Boykott 1926 aufgehoben wurde, verlängerten die gekränkten deutschen Mediziner in einem Gegen-Boykott ihre Isolation bis Anfang der 1930er Jahre. Als zweiter Faktor wirkte sich der wirtschaftliche Zusammenbruch negativ aus, verursacht durch die Kriegskosten selbst, die unrealistischen Reparationsforderungen aus dem Versailler Vertrag und die konsekutiven politischen Unruhen. Als weiteres Hemmnis erwies sich die unverändert autoritäre Struktur der akademischen Institutionen. Sie stand neuen Ideen einer medizinischen Subspezialisierung entgegen. Dennoch leistete die zweite Pioniergeneration wesentliche Beiträge zur Weiterentwicklung der Neurochirurgie.

Ihr bekanntester Vertreter wurde Otfrid Foerster (1873-1941), Er hatte nach einer zweijährigen Studienzeit bei Jules Déjérine in Paris und Heinrich Frenkel in der Schweiz seine neurologische Ausbildung bei Carl Wernicke im damaligen Breslau (heute: Wroclaw, Polen) erhalten. 1911 wurde er Leiter einer kleinen neurologischen Abteilung in einer Breslauer Klinik, erhielt 1917 einen persönlichen Lehrstuhl für Neurologie und wirkte ab 1920 im städtischen Wenzel-Hancke-Krankenhaus.
Schon seit 1908 hatte er gemeinsam mit Breslauer Chirurgen Eingriffe am Rückenmark durchgeführt, um zunächst mit gezielter Durchtrennung einzelner Hinterwurzeln die schwere Spastik bei Hirnkranken zu mildern („Foerstersche Operation“, 1908), ein Eingriff, der auch gegen die Schmerzkrisen bei der damals so häufigen Neuro-Syphilis half. Noch wirksamer gegen lokale Schmerzen erwies sich die direkte Unterbrechung der Schmerzbahn im Rückenmark, die er 1912 kurz nach, aber unabhängig von den Amerikanern Spiller und Martin durchführte. Obwohl selbst ohne chirurgische Grundausbildung, begann er während des Krieges mit selbstständigen Operationen an peripheren Nerven, weil nicht genügend Chirurgen verfügbar waren. Sehr bald folgten Eingriffe bei Tumoren des Rückenmarks und des Gehirns. Damit begründete Foerster neben der chirurgischen Schule eine primär neurologisch geprägte Schule der Neurochirurgie.
Im Gegensatz zum praxisorientierten Kliniker Fedor Krause war Foerster ein Wissenschaftler, der sich zeitlebens auf die funktionelle Neuroanatomie konzentrierte und mit jedem chirurgischen Eingriff auch den wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn suchte. Bedingt durch seine Ausbildung lag sein Hauptaugenmerk auf der Neuro-Rehabilitation: Er untersuchte die motorischen und sensiblen Bahnen des Rückenmarks, verbesserte das Schema der Dermatome und studierte den Effekt aktiver Übungen auf die Nervenfunktionen.
Wie Krause beschäftigte er sich auch mit der chirurgischen Behandlung der Epilepsie. Durch elektrische Stimulation der Hirnrinde schuf er Grundlagen für das heutige Brain Mapping.
In den 1920er Jahren gehörte Foerster zu den berühmtesten Neurologen der Welt. So wurde er 1922 als Mitglied eines beratenden Ärzteteams an Lenins Krankenbett gerufen. Ausländische Besucher wie Wilder Penfield und William Cone aus Kanada, Percival Bailey und Paul Bucy aus den USA bewunderten seine fundierten wissenschaftlichen Kenntnisse und seine elegante Operationstechnik am Nervengewebe. Gleichzeitig waren sie schockiert über die grobe Technik der Schädelöffnung, durchgeführt mit einem einfachen Handtrepan und in Straßenkleidung unter der Gummischürze. Wie Krause plante Foerster seine Hirnoperationen stets zweizeitig. Denn nicht nur der Patient, auch der Operateur benötigte vor dem eigentlichen Eingriff am Gehirn eine Erholungspause. 1930 war Foerster zu Gast bei dem amerikanischen Pionier der Neurochirurgie Harvey Cushing in Boston, wo er mit dem Titel „Surgeon-in-Chief pro tempore“ geehrt wurde. Die Rockefeller-Stiftung finanzierte für Foerster ein „Neurologisches Forschungsinstitut“, das schließlich 1934 eingeweiht werden konnte. Ab 1935 fasste Foerster sein Lebenswerk gemeinsam mit Oswald Bumke in einem 17-bändigen Handbuch der Neurologie zusammen. Er blieb an seinem Arbeitsplatz, bis er und seine Frau 1940 an Tuberkulose erkrankten, der beide im Abstand von nur zwei Tagen erlagen. Da seine Frau Halbjüdin war, hielten sich Gerüchte von ihrem Freitod, um Schikanen und Deportation durch das NS-Regime zu entgehen.

Emil Heymann (1878-1936) ist dagegen heute vielen Zeitgenossen unbekannt, obwohl er als Neurochirurg dem berühmten Breslauer Kollegen mindestens ebenbürtig, wahrscheinlich sogar überlegen war. Als Krauses Assistent seit 1903 und Oberarzt seit 1909 hatte er eine gründliche und umfassende allgemein- und neurochirurgische Ausbildung erfahren. Er hatte an Krauses Lehrbuch von 1908/11 mitgewirkt und noch vor dem Krieg mit seinem Chef die ersten beiden Teile eines sechs-bändigen chirurgischen Lehrbuchs verfasst.
Schließlich wurde er 1921 Krauses Nachfolger am Berliner Augusta-Hospital, wo er Krauses neurochirurgische Schule fortführte. Heymann wurde von Zeitzeugen als brillanter Operateur geschildert. Er war wie sein Lehrer in erster Linie Kliniker, der die Ergebnisse der operativen Eingriffe zu verbessern suchte.
Ebenso wie Foerster setzte er die neuen diagnostischen Möglichkeiten der Luftenzephalographie und der Myelographie mit positivem Kontrastmittel konsequent ein. 1929 übernahm er als Erster in Deutschland die von Cushing und Bovie kurz zuvor publizierte Technik der Elektrokoagulation mit Hochfrequenzstrom für die Hirnchirurgie und verbesserte Geräte und Handstücke. Er befasste sich mit der Chirurgie der Tumoren am Kleinhirnbrückenwinkel und konnte gegenüber Krause deutlich bessere Ergebnisse vorweisen. Besondere Expertise erwarb er in der Chirurgie der Tumoren im Wirbelkanal. Hirnoperationen führte Heymann wie sein Lehrer zweizeitig durch, bevorzugte aber die Lokalanästhesie, die er seit 1927 mit dem neuen rektalen Narkosemittel Tribromäthanol (Avertin®) ergänzte. Dass er ohne Handschuhe und Mundschutz operierte, war damals keineswegs unüblich. Obwohl in einem kleinen Haus überwiegend als Allgemeinchirurg tätig und mit bescheidenen Mitteln ausgestattet, war er als Neurochirurg national und international angesehen, wie in Anfragen u.a. der New Yorker Columbia-Universität zeigte. Er pflegte eine kollegiale Freundschaft sowohl mit Ferdinand Sauerbruch als auch mit dem schwedischen neurochirurgischen Pionier Herbert Olivecrona.
Einige Zeitgenossen Heymanns wurden ebenfalls neurochirurgisch aktiv. Alexander Stieda (1875-1966), Bramann-Schüler und nach dem Krieg in Halle-Weidenplan tätig, sammelte im Lauf seines Berufslebens ausgedehnte hirnchirurgische Erfahrungen. Nicolai Guleke (1878-1958), jüngster Schüler Ernst von Bergmanns, hatte 1919 den chirurgischen Lehrstuhl in Jena und damit eine der größten chirurgischen Kliniken Deutschlands übernommen. Er befasste sich besonders mit Tumoren des Wirbelkanals, später auch mit Hirntumoren. Sein neurologischer Partner war Hans Berger, der Erfinder des EEG. Arthur Woldemar Meyer (1885-1933), seit 1922 Leiter der Zweiten Chirurgischen Klinik in Berlin-Charlottenburg, entwickelte eine Messsonde, mit der er Hirntumoren anhand des elektrischen Gewebswiderstandes identifizieren konnte. Die Methode wurde in den 1950er Jahren in der damaligen DDR noch einmal aufgegriffen. Bekannter wurde Meyer wegen seiner erfolgreichen Operationen bei akuter Lungenembolie. Franz Schück, geboren als Franz Breslauer (1888-1958), Chirurg im Berliner städtischen Krankenhaus Am Urban, lieferte wichtige Erkenntnisse zur Pathogenese des sog. Sudeck-Syndroms und betonte die Rolle des Hirnstamms bei der Steuerung des Bewusstseins. Wilhelm Löhr (1889-1941) in Magdeburg führte 1933 die von Antonio Egas Moniz entwickelte Technik der Hirnangiographie in Deutschland ein, wobei er wegen des besseren Kontrastes radioaktives Thoriumdioxid verwendete. Dessen furchtbare Nebenwirkungen offenbarten sich erst Jahrzehnte später. Herbert Peiper (1890-1952) beschäftigte sich zur gleichen Zeit wie Heymann mit der Kontrastdarstellung des Wirbelkanals; er führte den Begriff „Myelographie“ ein. Heymann und Peiper wurden damals als wichtigste Experten der neuen Untersuchungstechnik zitiert. Keiner der Genannten betrachtete die Neurochirurgie als autonomes Spezialgebiet, sondern stets als Teilgebiet der großen allgemeinen Chirurgie.
Demgegenüber war die Verselbstständigung der Neurochirurgie im Ausland weiter fortgeschritten. Harvey Cushing (1869-1939) in den USA hatte sich seit 1904 ausschließlich auf die Chirurgie des Nervensystems konzentriert und diese Haltung auch offensiv vertreten. Mit seinen guten Operationsergebnissen erregte er bald Aufsehen, zog daher zahlreiche Stipendiaten und Gastärzte an, die seine Ideen weltweit verbreiteten. Cushing führte seine Erfolge auf die ausschließliche Beschäftigung mit dem Nervensystem und auf spezielle Techniken und Hilfsmittel zurück: So hatte er schon 1901 das Narkoseprotokoll mit Blutdrucküberwachung eingeführt, 1911 den Gefäßclip und ab 1918 – unabhängig von Ernst Unger – stufenweise den chirurgischen Sauger, der sich bis Mitte der 1920er Jahre annähernd zur heutigen Form entwickelt hatte. 1927 folgte die entscheidende Abwandlung eines Diathermie-Apparates zur elektrischen Verschorfung blutender Gefäße, ohne dass der Strom am Gehirn Krampfaktivität auslöste. Die Teilung der Hirnoperationen in zwei Zeiten hatte er frühzeitig aufgegeben, ebenso die Auslösung der Hirntumoren mit dem Finger. Vor allem vertrat er bei Hirntumoren ein anderes Prinzip als bisherige Chirurgen, die durch Umfahren der Tumorgrenzen eine radikale Exstirpation anstrebten. Cushing höhlte die Tumoren zunächst aus und ließ notfalls eine Tumorschale stehen, wenn ihre Entfernung zu riskant erschien. Denn er hatte die Erfahrung gemacht, dass nachwachsendes Tumorgewebe und sogar die Tumorkapsel in manchen Fällen in einer zweiten Operation erfolgreich entfernt werden konnten. Bis Anfang der 1930er Jahre war – mit Ausnahme der Elektrokoagulation - keine dieser Methoden in Deutschland üblich. Cushing, seit 1912 Chef in Boston, hatte 1920 zusammen mit eigenen Schülern und anderen interessierten Kollegen die erste neurochirurgische Fachgesellschaft der Welt gegründet, der schon 1932 eine zweite nationale Gesellschaft folgte. In Großbritannien entstand 1926 eine eigene Gesellschaft, und 1936 bildeten auch holländische Cushing-Schüler eine neurochirurgische Organisation.
Bemühungen um Eigenständigkeit
In Deutschland begann eine junge Generation erst etwa ab Mitte der 1920er Jahre, nach dem amerikanischen Vorbild sich ganz auf die Neurochirurgie zu konzentrieren. Walter Lehmann (1888-1960) aus Göttingen, der sich seit dem Krieg mit der Chirurgie peripherer Nerven einen Namen gemacht hatte, bemühte sich 1926 nach einer USA-Reise vergeblich um eine Anerkennung der Neurochirurgie als neue Disziplin. Ludwig Guttmann (1899-1980), erster Schüler von Otfrid Foerster, baute 1928 in Hamburg eine neurochirurgische Station auf, kehrte jedoch bald wieder nach Breslau zurück, um seinen Lehrer in einer personellen Notsituation zu unterstützen. Alice Rosenstein (1898-1991), ebenfalls Foerster-Schülerin, arbeitete ab 1929 in Frankfurt unter Karl Kleist als Neuroradiologin und – als erste Frau der Welt – auch als Neurochirurgin. Bernhard Badt (1893-1972), als Neurologe unter anderem Foerster-Schüler, folgte Guttmann 1930 auf die neurochirurgische Station in Hamburg-Friedrichsberg. Er vertiefte seine Ausbildung später über mehrere Jahre bei Herbert Olivecrona in Stockholm. Carl Felix List (1902-1968) wurde nach vierjähriger neurologischer Ausbildung bei Otfrid Foerster und Paul Schuster von Moritz Borchardt angeworben und 1931 auf dessen Kosten für ein Jahr zu Cushing geschickt. Denn Borchardt beabsichtigte, gemeinsam mit dem Neurologen Kurt Goldstein in Berlin-Moabit eine neurochirurgische Abteilung einzurichten. Auch der Leipziger Neurologe Jost Joseph Michelsen (1904-1989) entschied sich 1932 als Stipendiat in Boston für die neurochirurgische Laufbahn. Alle Bemühungen aus dieser Gruppe, die Neurochirurgie als eigenständiges Fachgebiet zu etablieren – 1926 von Lehmann, 1928 von Heymann und 1932 von Borchardt und List – scheiterten an berufspolitischen Widerständen oder wurden auf Eis gelegt.
Verfolgung deutscher Neurochirurgen im Nationalsozialismus
Die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler Ende Januar 1933 hatte für die Neurochirurgie in Deutschland erneut weitreichende Folgen. Als eine der ersten Maßnahmen der NS-Regierung wurden alle jene Ärzte aus ihrem Amt entfernt oder zumindest konsequent boykottiert, die nach einer willkürlichen Definition zu Juden erklärt worden waren. Diese Maßnahme traf neun von 20 Institutionen, die Neurochirurgie als Arbeitsschwerpunkt betrieben, aber nahezu alle, die sich vollständig spezialisieren wollten. Besonders betroffen war Berlin, wo die leitenden Ärzte in fünf von sechs Arbeitsstätten gedemütigt und vertrieben wurden: Emil Heymann im Augusta-Hospital, Moritz Borchardt (Krankenhaus Moabit), Ernst Unger (Ungersche Klinik), Arthur Woldemar Meyer (Krankenhaus Westend), Franz Schück (Urban-Krankenhaus). Unger konnte in seiner Privatklinik zunächst noch weiterarbeiten und Heymann wurde erst zum Frühjahr 1936 von seinem Arbeitgeber, dem Deutschen Roten Kreuz, formell entlassen. Meyer erschoss seine „halbjüdische“ Frau und sich selbst im November 1933, vermutlich, weil er die Inhaftierung befürchtete, nachdem er Geld in die Schweiz transferiert hatte – damals ein hart bestraftes Vergehen. Foersters Oberarzt Guttmann konnte zunächst auf das Israelitische Krankenhaus in Breslau ausweichen. Letztlich wurden alle Betroffenen zur Aufgabe gezwungen: Emil Heymann erlag im Januar 1936 kurz vor seiner Emigration nach Chile einem Herzinfarkt, Ernst Unger wurde Opfer von Kriminellen und starb nach einem Verkehrsunfall. Alle anderen emigrierten, sechs von ihnen letztlich in die USA, teilweise über europäische Länder, zwei nach Großbritannien, Borchardt nach Argentinien. Nur Carl Felix List und Jost Joseph Michelsen gelang es, in ihrem Gastland als Neurochirurgen Fuß zu fassen. Andere fanden eine Position als Nervenärzte, so Alice Rosenstein, die sich eine hochrangige Position in der US Army erarbeitete. Ludwig Guttmann revolutionierte in England die Behandlung der Querschnittslähmungen und gründete die Paralympischen Spiele. Walter Lehmann konnte seine Tätigkeit zunächst in Albanien, seinem ersten Exil, fortsetzen und gilt heute als Begründer der dortigen Neurochirurgie. Nach erneuter Flucht in die USA blieben seine Bemühungen um beruflichen Anschluss vergeblich. Auch Franz Schück fand im amerikanischen Exil keine angemessene Anstellung mehr. Bis auf Guttmann sind die genannten Namen in Deutschland heute weitgehend vergessen – das NS-Regime hatte sie – unter bereitwilliger Mitwirkung ihrer „arischen“ Kollegen – zielstrebig aus dem öffentlichen Bewusstsein verdrängt. Dieselben Kollegen mochten sich auch nach dem Krieg nicht mehr an die Verfolgten erinnern.

Beginnende Eigenständigkeit – der Zweite Weltkrieg
Die Chance, das junge Fachgebiet in die Selbstständigkeit zu führen, erhielt ein anderer: Wilhelm Tönnis (1898-1978). Er füllte in Berlin die Lücke an hirnchirurgischer Kompetenz, die 1936 nach Heymanns Tod augenfällig wurde. Tönnis war es 1934 erstmals gelungen, die Neurochirurgie mit ministeriellem Segen als eigenständiges Fachgebiet zu etablieren. Geboren im Ruhrgebiet, hatte er 1924 eine chirurgische Ausbildung bei Victor Schmieden in Frankfurt begonnen, wo er u.a. Herbert Peiper als älteren Assistenten kennenlernte. 1926 wechselte er zu dem Bergmann-Schüler Fritz König nach Würzburg. Bereits 1929 habilitierte er sich für das Fach Chirurgie. Danach bat er seinen Chef um Unterstützung für eine Spezialisierung in Neurochirurgie. Königs Anfrage bei Cushing wurde negativ beantwortet. Herbert Olivecrona in Stockholm, mit König gut bekannt, erklärte sich dagegen bereit, Tönnis als Gastarzt aufzunehmen. Nach einer kurzen neurologischen Grundausbildung in Hamburg arbeitete Tönnis 1932 als Rockefeller-Stipendiat sieben Monate bei Olivecrona, einem neurochirurgischen Autodidakten, aber überzeugten Anhänger der Cushing-Schule. Außer den speziellen Techniken Cushings erlernte Tönnis bei Olivecronas Mitarbeiter Erik Lysholm, dem damals europaweit führenden Neuroradiologen, die differenzierte Interpretation der Pneumenzephalographie (Kontrastierung der Liquorräume mit Luft). Nach seiner Rückkehr sorgte er in Würzburg mit der erfolgreichen Nachoperation einiger Patienten mit zuvor nicht entdeckten Hirntumoren für Aufsehen. Mit Unterstützung Königs konnte Tönnis im August 1934 die erste deutsche, von der bayerischen Regierung genehmigte Abteilung für Neurochirurgie errichten.

Nachdem König in den Ruhestand geschickt worden war, suchte Tönnis nach einer selbstständigen Position. Mit Königs Hilfe nahm er Kontakt zur Universität Berlin auf – und hatte Erfolg: Zum April 1937 wurde er auf das erste deutsche Extraordinariat für Neurochirurgie und Direktor der neurochirurgischen Universitätsklinik in der Klinik am Hansaplatz berufen - gegen den Widerstand des chirurgischen Lehrstuhlinhabers. Gleichzeitig erhielt er die Leitung einer Forschungsabteilung im Kaiser-Wilhelm-Institut für Hirnforschung, das seit kurzem unter der Leitung des befreundeten Neuropathologen Hugo Spatz stand. Dabei erwiesen sich die neuen politischen Verhältnisse als sehr hilfreich: So war die Universität bei den Berufungen formal gar nicht eingebunden. Außerdem erhielt die Hirnchirurgie durch das NS-Regime jetzt politische Unterstützung. Denn 1936 hatten mit dem Vier-Jahresplan die Kriegsvorbereitungen begonnen, und die Regierung hatte die militärische Bedeutung des neuen Faches erkannt. Tönnis fügte sich in das politische System ein und wurde im Herbst 1937 Mitglied der NSDAP. Als Neurochirurg bemühte er sich von Anfang an um internationale fachliche Kontakte. 1936 gründete er die weltweit erste spezielle Fachzeitschrift, das „Zentralblatt für Neurochirurgie“, mit einem internationalen Herausgeberstab. 1937 gelang es ihm, die Britischen Neurochirurgen zu ihrer turnusmäßigen Auslandstagung nach Berlin zu holen – zusätzlich auch nach Breslau als Referenz an Foerster.
Neben den neurochirurgischen Abteilungen in Berlin und Breslau gab es Anfang 1937 nur wenige kleine eigenständige Einheiten, so in den neurologischen Kliniken von Hamburg (Otto Hinrich Voss), Frankfurt (Tönnis-Schüler Traugott Riechert) und Breslau-St. Georg (Foerster-Schüler Friedrich-Wilhelm Kroll) sowie in der chirurgischen Klinik Hannover-Nordstadt (Otto Glettenberg, 1894- 1955). Auch in München existierte seit Beginn des Jahres 1937 eine kleine Abteilung unter der Leitung von Franz Karl Kessel (1900-1974). Der Österreicher hatte in den vorangegangenen drei Jahren eine hervorragende Ausbildung erhalten durch Aufenthalte bei de Martel in Paris, Schönbauer in Wien und zuletzt während 18 Monaten bei Olivecrona in Stockholm. Dieser exzellente Fundus kam in Deutschland aber nicht zum Tragen, weil auch Kessel wegen seiner jüdischen Ehefrau 1939 zur Emigration gezwungen wurde.
Bis zum Ausbruch des Krieges wurden weitere neurochirurgische Einrichtungen geschaffen, so dass sich die Gesamtzahl auf neun erhöhte. Freie Stellen konnte Tönnis überwiegend mit eigenen Schülern besetzen. Neben Traugott Riechert waren es: Gerhard Okonek (1906-1961) in Göttingen, Georg-Friedrich Häussler (1904-1977) in Hamburg, Peter Röttgen (1910-1995) in Bonn, Erich Fischer (später: Fischer-Brügge, 1904-1951) in Münster. Arist Stender (1903-1975), Oberarzt von Otfrid Foerster in Breslau, leitete jetzt eine eigene neurologisch-neurochirurgische Station. Felix Jaeger in München, Schüler von Georg Magnus, übernahm 1939 Kessels neurochirurgische Abteilung, nachdem letzterer mit seiner jüdischen Frau nach England geflohen war. Tönnis‘ Aufruf zur Gründung einer nationalen Fachgesellschaft im Herbst 1939 wurde mit dem Beginn des Zweiten Weltkrieges hinfällig.
Erneut wurden die chirurgischen Abteilungen zu Lazaretten umgewandelt, die neurochirurgischen Einheiten entsprechend zu Speziallazaretten für Hirnverletzte. Tönnis wurde beratender Neurochirurg der Luftwaffe, später der gesamten Wehrmacht und stieg dabei bis zum Rang eines Generalarztes auf. Er richtete, ähnlich wie Hugh Cairns in Großbritannien, mobile Operationseinheiten ein, um die Prognose der offenen Hirnverletzungen zu verbessern. Außerdem organisierte er den Lufttransport der frisch Verwundeten nach Erstversorgung in eines der Heimatlazarette für Hirnverletzte und sorgte für intensive Rehabilitationsmaßnahmen. Dafür erhielt er internationale Anerkennung.
Neurochirurgie in der Bundesrepublik
Der Zweite Weltkrieg endete für Deutschland nicht nur in einer physischen, sondern wegen der zahlreichen Gräueltaten unter dem NS-Regime mehr noch in einer psychischen und moralischen Katastrophe. Viele Städte lagen in Trümmern, auch Tönnis‘ Hansaklinik in Berlin war zerstört. Die Sowjetunion hatte sich nach Westen ausgedehnt und Polen dabei verschoben: Breslau hieß jetzt Wroclaw und lag auf polnischem Staatsgebiet. Aus vier deutschen Besatzungszonen entwickelten sich 1949 zwei separate Staaten, vier Jahrzehnte lang geteilt durch den Eisernen Vorhang als Symbol des Kalten Krieges. Die Bevölkerung war in der Nachkriegszeit vor allem mit den eigenen Verlusten, mit dem Überlebenskampf und dem Wiederaufbau beschäftigt und blendete die eigene Verantwortung an den NS-Verbrechen lange aus. Auch die Bemühungen der Besatzungsmächte um eine politische Säuberung scheiterten letztlich an der großen Zahl der betroffenen Personen. Schon in den ersten Nachkriegsjahren wurden zahlreiche neurochirurgische Abteilungen gegründet, um die vielen Kriegsopfer zu versorgen. Sie wurden meistens von Neuro-chirurgen mit Kriegserfahrung geleitet, von denen die große Mehrheit in unterschiedlichem Ausmaß mit dem NS-System verbunden gewesen war. Wesentliche Nachteile hatten nur wenige von ihnen in Kauf zu nehmen. Wilhelm Tönnis konnte bereits im Frühjahr 1946 im Knappschafts-Krankenhaus Bochum eine große chirurgische Abteilung übernehmen. Von hier aus baute er die neurochirurgische Disziplin zielgerichtet weiter aus. So erschien ab 1949 wieder das „Zentralblatt“, das 1943 kriegsbedingt eingestellt worden war. 1950 wurde endlich die „Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie“ gegründet. Ein Jahr zuvor war Tönnis nach Köln auf den ersten ordentlichen Lehrstuhl für Neurochirurgie berufen worden.1951 zog er mit einem Teil seines Bochumer Teams in einen Kölner
Auch in der Kölner Klinik blieben die Hirntumoren das wichtigste Forschungsgebiet. Histologische Befunde und klinische Verläufe bildeten die Grundlage einer Tumorklassifikation, entwickelt von Tönnis‘ langjährigem Mitarbeiter Klaus-Joachim Zülch (1910-1988), die 1979 von der Weltgesundheitsorganisation als internationaler Standard übernommen wurde. Ab 1954 gab Tönnis zusammen mit seinem Mentor Olivecrona ein 12-bändiges Handbuch der Neurochirurgie heraus, das 1974 schließlich vollendet wurde. Am nachhaltigsten dürften aber seine Bemühungen um die Etablierung der Neurochirurgie als akademisches Lehrfach gewesen sein. Viele seiner Schüler und „Enkel“-Schüler gründeten im westlichen Teil Deutschlands neue Abteilungen, die später zu Lehrstühlen aufgewertet wurden. Zu den oben schon Genannten kamen nach dem Krieg u.a. hinzu: Rupert Strohmayer (1906-??) in Bremen (1949), Wilhelm Klug (1910-2001) in Bochum (1951), Eduard Weber in München (1952), Hans-Werner Pia (1921-1986) in Gießen (1953), Kurt Schürmann (1920-2006) in Mainz (1955), Wolfgang Schiefer (1919-1980) in Erlangen (1958) und Friedrich Loew (1920-2018) in Homburg/Saar (1960).
Auch einige Schüler Otfrid Foersters konnten nach dem Krieg eigene neurochirurgische Abteilungen einrichten. Arist Stender (1903-1975) baute ab 1946 in Berlin-Charlottenburg eine Klinik für Neurologie und Neurochirurgie auf, eine einmalige Kombination, die bis zu seiner Emeritierung erhalten blieb. Ernst Klar (1909-1967) und Hans Kuhlendahl (1910-1992) wurden ab 1947 in Heidelberg bzw. Düsseldorf tätig. Der Foerster- und Stender-Schüler Helmut Penzholz (1913-1985) wurde 1967 Nachfolger von Ernst Klar.

Neben dieser kleineren, neurologisch geprägten Schule bildete sich eine dritte Gruppe um Traugott Riechert (1905-1983), der 1946 in Freiburg auf das zweite deutsche Extraordinariat berufen wurde. Zu seinen Mitarbeitern gehörten u.a. Fritz Mundinger (1924-2012), Wilhelm Umbach (1915-1976) und Robert Hemmer (1920-1998). Die Freiburger Arbeitsgruppe wurde besonders bekannt durch ihre Arbeiten auf dem Gebiet der Stereotaxie und der Kinderneurochirurgie.
Aus dem Exil kehrte nur Franz Karl Kessel zurück. Nach u.a. achtjähriger Tätigkeit unter dem berühmten englischen Neurochirurgen Geoffrey Jefferson eröffnete er 1955 als britischer Staatsangehöriger in München eine kleine Fachabteilung, wenig beachtet und sicherlich unterschätzt. Von den deutschen neurochirurgischen Kollegen und der Fachgesellschaft hielt er sich fern.
1956 wurde in Westdeutschland der Facharzt für Neurochirurgie eingeführt. Die zunehmende Bedeutung des Faches spiegelte sich in der Mitgliederzahl der wissenschaftlichen Gesellschaft wider: Hatte sie in den frühen 1950er Jahren noch unter 50 gelegen, war sie bis 1962 auf 154 gestiegen und vervielfachte sich bis zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung beider deutscher Staaten 1990 noch einmal auf 631.
Als Reaktion der Alliierten auf den deutschen Angriffskrieg und die NS-Verbrechen wurden deutsche Wissenschaftler in der Nachkriegszeit international erneut weitgehend isoliert. 1949 durfte Arist Stender erstmals einen kurzen historischen Artikel im US-amerikanischen „Journal of Neurosurgery“ publizieren, der Zeitschrift, die 1944 als Reaktion auf die Einstellung des „Zentralblatts“ gegründet worden war. 1951 wurde er als vermutlich erster deutscher Neurochirurg zu einem Besuch in die USA eingeladen und gehörte ab 1955 als deutscher Vertreter schließlich zu einem Komitee, das die Gründung der „World Federation of Neurosurgical Societies“ (WFNS) vorbereitete. Bei diesen Vorbereitungen kam es auch zu ersten Gesprächen über eine Vereinigung auf europäischer Ebene, im Wesentlichen initiiert von dem Franzosen Marcel David. Sie führten zunächst 1958 zu einer gemeinsamen Tagung der deutschen und schweizerischen Gesellschaften auf „neutralem“ Boden in Zürich unter den Präsidenten Peter Röttgen und Hugo Krayenbühl. Bereits ein Jahr später folgte der „Erste Europäische Kongress für Neurochirurgie“, organisiert an demselben Ort und von denselben beiden Gesellschaften, jetzt unter Krayenbühl und Joachim Gerlach, mit Beteiligung zahlreicher anderer europäischer Länder. Diese Aktivitäten mündeten schließlich 1971in Prag in die Gründung der „European Association of Neurosurgical Societies“ (EANS). Zu einem wichtigen Meilenstein im Aussöhnungsprozess wurde außerdem die gemeinsame Tagung mit der Niederländischen Gesellschaft 1960 in Rotterdam.
Entscheidende Protagonisten auf deutscher Seite in diesem Prozess kamen aus der Tönnis-Schule. Friedrich Loew war nicht nur an der Organisation der genannten Tagungen und dem Aufbau der EANS beteiligt, sondern sorgte auch dafür, dass die von ihm betreute Zeitschrift Acta Neurochirurgica zum offiziellen Organ der EANS gewählt wurde. Hans-Werner Pia wurde zum ersten Vorsitzender des wichtigen „Training Committee“ der EANS, und Kurt Schürmann 1974 als erster Deutscher in das Präsidium der EANS gewählt. Karl-August Bushe gehörte schon 1967 zum Gründungskomitee der Europäischen Gesellschaft für Pädiatrische Neurochirurgie ESPN. 1981 wurde er schließlich Präsident des Siebten Neurochirurgischen Weltkongresses in München. Erster deutscher Präsident der Europäischen Neurochirurgischen Gesellschaft EANS wurde 1991 Mario Brock. Der Schürmann-Schüler Madjid Samii wurde 1997 zum Präsidenten der Internationalen Gesellschaft WFNS gewählt.

Neurochirurgie in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR)
Im östlichen Teilstaat erlangte Georg Merrem (1908-1971) eine ähnliche Bedeutung wie Wilhelm Tönnis im Westen. Als Schüler Emil Heymanns und dessen Nachfolger Carl Max Behrend war er 1948 von Arwed Pfeifer an die Leipziger Neurologische Klinik geholt worden, um eine neurochirurgische Abteilung aufzubauen. Merrem blieb der Einzige, der mit dem Aufbau einer eigenen Schule die Tradition von Krause und Heymann fortsetzte. Dank seines Einflusses wurde der Facharzt für Neurochirurgie in der DDR schon 1955 eingeführt, ein Jahr früher als im westlichen Teil Deutschlands. 1959 erhielt Merrem den ersten und einzigen Lehrstuhl für Neurochirurgie in der DDR. Seine Schüler sorgten für die Verbreitung des neurochirurgischen Faches, unter ihnen Friedrich Weickmann (1913-1983), Günther Niebeling (1923-2010), Siegfried Krumbholz (1928-2005), Horst Fried (1931-1998) und Peter Schaps (geb. 1932). Zusammen mit seinem Assistenten und Schwiegersohn Wolf-Eberhard Goldhahn verfasste Merrem 1960 ein neurochirurgisches Lehrbuch und 1966 einen Operationsatlas, Bücher, die auch in Westdeutschland verbreitet waren.
Neben Merrem konzentrierten sich auch einige Allgemeinchirurgen auf das Nervensystem, nachdem sie bei ausländischen Neurochirurgen hospitiert hatten. Dazu gehörten Willi Felix (1892-1962) in Berlin, Hans Joachim Serfling (1913-2004) in Greifswald und Berlin sowie Werner Usbeck (1920-2007) in Erfurt. Die Assistenten der beiden Letztgenannten, Rudolf Unger (geb. 1923), Joachim Reichel (1924-2011) und Helmut Pothe (geb. 1932), spezialisierten sich anschließend vollständig auf das neue Fach. Werner Budde in Halle und Werner Lembcke in Magdeburg förderten von sich aus die Spezialisierung und richteten fachlich autonome Abteilungen ein.
Nachdem 1961 die DDR die Grenze zwischen beiden deutschen Staaten abgeriegelt hatte, um den Exodus politischer Flüchtlinge zu stoppen, gründete Merrem eine eigene Fachgesellschaft, die “Vereinigung der Neurochirurgen in der DDR”. Er organisierte 1963 in Leipzig auch den ersten Kongress der neuen Gesellschaft. Verglichen mit ihren westdeutschen Kollegen hatten die Neurochirurgen der DDR mit größeren Schwierigkeiten zu kämpfen. Die Mehrzahl der ostdeutschen Allgemeinchirurgen wehrte sich erfolgreich gegen die Verselbstständigung des Faches. So setzte die Anerkennung als Facharzt für Neurochirurgie eine volle Weiterbildungszeit für Allgemeinchirurgie voraus, der sich die drei- bis vierjährige Spezialausbildung erst anschloss. 1967 wurde der neurochirurgische Facharzt aus bislang ungeklärten Gründen wieder abgeschafft, 1974 aber erneut eingeführt. In den 1960er und 1970er Jahren gab es acht neurochirurgische klinische Einrichtungen, die annähernd 16 Millionen Menschen zu versorgen hatten. Bis zum Herbst 1990 erhöhte sich ihre Zahl auf 14, verteilt auf sechs Universitäten (Berlin-Charité, Greifswald, Halle, Jena, Leipzig, Rostock), drei Medizinische Akademien (Dresden, Erfurt, Magdeburg), vier kommunale Kliniken (Berlin-Buch, Berlin-Friedrichshain, Chemnitz, Schwerin) und ein Militärkrankenhaus (Bad Saarow). Außer dem einzigen Lehrstuhl in Leipzig und den selbstständigen städtischen Kliniken in Berlin-Buch und (erst seit 1989) Schwerin waren diese Einrichtungen chirurgischen Direktoren unterstellt. Die Fachgesellschaft, seit 1967 “Gesellschaft für Neurochirurgie der DDR”, umfasste 1990 insgesamt 130 Mitglieder, aber nur etwa 40 aktive Neurochirurgen. Zur selben Zeit zählte die westdeutsche Gesellschaft 630 Mitglieder, die in 85 Einrichtungen eine Bevölkerung von 63 Millionen versorgten.
Ein zweites Problem resultierte aus der Politik der ostdeutschen Regierung, die auf strenge Abgrenzung gegenüber Westdeutschland achtete und sich politisch weitgehend an den Ländern des Ostblocks orientierte. Als Folge blieb der ostdeutsche Staat in großen Teilen der wissenschaftlichen Welt relativ isoliert. 1976 wurden die westdeutschen Mitglieder auf Anordnung der DDR-Behörden aus der Redaktion des „Zentralblatts für Neurochirurgie“ entfernt. Die Zahl der eingereichten Beiträge aus „nicht-sozialistischen“ Ländern sank danach dramatisch und „Neurosurgical Review“ wurde als westdeutscher Ersatz gegründet. Dennoch war die ostdeutsche Fachgesellschaft in internationalen Dachverbänden gut vertreten. So legte die European Association of Neurosurgical Societies EANS großen Wert darauf, alle Europäischen Ostblockländer zu integrieren. Entsprechend wurde Rudolf Reinhold Unger als Präsident des Europäischen Fortbildungskurses 1989 in Berlin gewählt. Letztlich wurde der Kurs von Ungers Nachfolger Günter Lang organisiert und der Tagungsort nach Rostock-Warnemünde verlegt.
Schließlich führten die massiven Reparationsforderungen der Sowjetunion, die starre, zentralistische Organisation der Wirtschaft und die ökonomische Bindung an die Sowjetunion zu einem chronischen Mangel an westlichen Devisen und damit zu einem Mangel an westlichen Waren, insbesondere High-tech-Geräten. Trotz dieser Schwierigkeiten entsprach die Neurochirurgie in der DDR internationalem Standard und erzielte bemerkenswerte Ergebnisse. So wurden schon in den 1960er Jahren schwierige Gefäßoperationen routinemäßig unter kontrollierter Hypothermie und Hypotension durchgeführt. Neu entwickelte Methoden umfassten die intraoperative Vitalfärbung von Tumorgewebe mit fluoreszierenden Tetrazyklinen und die Bestimmung des Malignitätsgrades von Tumoren anhand des elektrischen Gewebswiderstandes. Die interventionelle Neuroradiologie nach russischem Vorbild wurde bereits 1973 praktiziert.
1989 forderte eine zunehmende Zahl ostdeutscher Bürger politische Veränderungen. Die Demonstrationen führten schließlich zum Fall der Berliner Mauer, damit zur Öffnung des „Eisernen Vorhangs“ und endeten mit der Forderung nach Wiedervereinigung. Sie wurde mit dem Deutschen Einigungsvertrag am 3. Oktober 1990 Wirklichkeit und bedeutete die Integration des ostdeutschen Staates in die Bundesrepublik. Kurz danach beschloss die ostdeutsche neurochirurgische Fachgesellschaft auf ihrer letzten Jahrestagung in Cottbus ihre Auflösung. Nach der Wiedervereinigung verloren einige neurochirurgische Klinikleiter ihre Stellung wegen des Vorwurfs, das frühere totalitäre politische System aktiv unterstützt zu haben. Da ihre Nachfolger vielfach aus Westdeutschland kamen, fühlten sich nicht wenige als Opfer einer ungerechtfertigten politischen Säuberungsaktion.

Vorbereitungstreffen zur Vereinigung der beiden deutschen neurochirurgischen Fachgesellschaften, Dresden, 24. Feb. 1990
Sitzend v. li. n. re: Günter Lang (Greifswald), Rüdiger Lorenz (Frankfurt/M), Wolf-Dieter Siedschlag (Berlin-Buch), Wolfgang Bock (Düsseldorf), Friedrich Loew (Homburg/Saar), Helmut Pothe (Erfurt).
Stehend v. li. n. re: Mario Brock (Berlin-Steglitz), Evangelos Markakis (Göttingen), Rudolf Fahlbusch (Erlangen), Johannes Schramm (Bonn), Bernhard L. Bauer (Marburg), Reinhold Frowein (Köln), Peter Schaps (Dresden), Siegfried Vogel (Berlin, Charité), Hermann Dietz (Hannover).
Neurochirurgie im vereinigten Deutschland
Seit 1990 wurden im vereinigten Deutschland 30 weitere neurochirurgische Einheiten errichtet, davon 18 in den östlichen Bundesländern. Gleichzeitig wurden zahlreiche kommunale Kliniken in kommerzielle Trägerschaft überführt. Zusätzlich entstanden viele private Praxen, so dass die neurochirurgische Versorgung zu einem guten Teil in private, gewinnorientierte Hände überging. 2017 gab es etwa 2300 aktive Neurochirurgen, zuständig für eine Bevölkerung von 82 Millionen. Neben 43 Universitätskliniken haben sich annähernd 140 kommunale und kommerzielle Häuser und über 200 Praxen etabliert. Insgesamt werden in Deutschland jährlich etwa 750.000 neurochirurgische Eingriffe durchgeführt.
In Forschung und klinischer Praxis hatte die Neurochirurgie in Deutschland schon nach dem Ersten Weltkrieg den Anschluss an die internationale Spitze verloren und bis zum Zweiten Weltkrieg den Rückstand nicht vollständig aufgeholt. Retrospektiv lässt sich nur schwer abschätzen, ab wann der Weltstandard wieder erreicht wurde. Wichtige Meilensteine auf diesem Weg bedeuteten die Einführung der Mikrochirurgie um 1970 und die wenig später folgende Computertomographie.
Einige Persönlichkeiten leisteten herausragende Beiträge zu dieser Entwicklung, so Hans Werner Pia (Gießen) in der Chirurgie der Aneurysmen und Angiome, Kurt Schürmann (Mainz) auf dem Gebiet der Orbita- und Schädelbasis-chirurgie, Rudolf Fahlbusch (Erlangen) und Dieter Lüdecke (Hamburg) in der Chirurgie der Hypophyse und Madjid Samii (Hannover) in der Chirurgie der Schädelbasis und besonders der Vestibularisschwannome, außerdem Friedrich Weickmann (Berlin-Buch) und Robert Hemmer (Freiburg) in der pädiatrischen Neurochirurgie. Michael Gaab (Hannover), Dieter Hellwig und Bernhard Ludwig Bauer (beide Marburg) befassten sich mit der endoskopischen Operationstechnik, Peter Schaps (Dresden) wurde zu einem Vorreiter der interventionellen Neuroradiologie.
Auf diagnostischem Gebiet sind Reinhold Frowein (Koma und Hirntod) und Ekkehard Kazner (Ultraschall und Computertomographie) hervorzuheben. Auch in der Grundlagenforschung wurden einige Namen weltweit bekannt: Wolfgang Seeger (chirurgische Anatomie), Alexander Baethmann (Sekundärschädigung nach Trauma und Ischämie), Hans-Jürgen Reulen (Hirnödem) und Mario Brock (Hirndruckmessung). Rudolf Kautzky erhielt hohe Anerkennung für seine Beiträge zu ethischen Problemen. Hans Kuhlendahl engagierte sich in der AWMF, einer Dachorganisation medizinischer Fachgesellschaften zur Verbesserung von Ausbildung und Versorgung und etablierte ein regelmäßiges Diskussionsforum mit Juristen.
Die deutsche Neurochirurgie wird heute durch drei Gesellschaften repräsentiert. Zusätzlich zur wissenschaftlichen Fachgesellschaft mit ihren derzeit (2017) über 1700 Mitgliedern gibt es den Berufsverband Deutscher Neurochirurgen BDNC, der 1989 gegründet wurde und aus einer Kommission „Berufsfragen“ hervorging. Er kümmert sich besonders um berufspolitische Probleme, aber auch um die stetige Weiterbildung. 1996 kam eine Deutsche Akademie für Neurochirurgie (DANC bzw. GANS = German Academy of Neurosurgery) hinzu. Sie wurde nach amerikanischem Vorbild von einigen Lehrstuhlinhabern unter dem Eindruck der zunehmenden Zahl frei praktizierender Neurochirurgen gegründet, um die Neurochirurgie an den Universitäten zu stärken.
Im Bewusstsein, dass es sich bei der Neurochirurgie um ein vergleichsweise kleines Fachgebiet handelt, traf die Fachgesellschaft 2008 eine bedeutende berufspolitische Entscheidung: Sie kehrte in den Dachverband der Chirurgen zurück.
Die neurochirurgische Ausbildung ist weitgehend, wenn auch nicht ausschließlich, an Kliniken gebunden und umfasst eine strukturierte, mindestens sechsjährige Tätigkeit in grundlegenden diagnostischen und chirurgischen Techniken sowie allgemeiner Patientenbetreuung. Besondere Kenntnisse in der Ultraschalldiagnostik werden ebenso gefordert wie eine mindestens halbjährige (in der Praxis meist längere) intensivmedizinische Ausbildung. Das frühere Pflichtjahr in allgemeiner Chirurgie wurde aufgegeben, wird aber als fakultative Weiterbildung angerechnet. Auch in anderen Fächern werden Ausbildungszeiten zum Teil akzeptiert. Ausbildungszeiten und der Operationskatalog werden in einem Logbuch erfasst, das auf europäischer Ebene entwickelt wurde. Die mit der Facharztausbildung, einer weiteren Spezialisierung und der Versorgungs-qualität zusammenhängenden Fragen werden in den Referaten einer „Neurochirurgischen Akademie für Aus-Fort- und Weiterbildung“ bearbeitet. Sie wird von der Fachgesellschaft und dem Berufsverband gemeinsam getragen und richtet u.a. jährliche Fortbildungskurse zur Förderung des Nachwuchses aus. Innerhalb der Fachgesellschaft widmet sich eine Reihe von Arbeitsgruppen (Sektionen) dem wissenschaftlichen Fortschritt auf verschiedenen Teilgebieten.
Seit ihrer Gründung verleiht die Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie an herausragende Wissenschaftler die Ehrenmitgliedschaft. Der Chirurg Nicolai Guleke und der Neurologe Karl Kleist waren die ersten so Geehrten. Außerdem wurden Ehrenmedaillen gestiftet, um besondere Verdienste auf wissenschaft-lichem Gebiet oder für die Fachgesellschaft zu würdigen. Dazu gehören die Fedor-Krause-Medaille und die Otfrid-Foerster-Medaille, 1953 gestiftet und verliehen für hervorragende Beiträge zur Neurochirurgie bzw. zur Neurophysiologie. Seit 1989 wird außerdem die Wilhelm-Tönnis-Medaille verliehen „für überragende Beiträge zur Neurochirurgie auf klinischem, experimentellen oder organisatorischen Gebiet“. 1995 kam die Fritz-König-Medaille hinzu, mit der auch Nichtmediziner geehrt werden können, die für die Fachgesellschaft Außerordentliches geleistet haben. Mehrere Stiftungen wie die Wilhelm-Tönnis-Stiftung und die Stiftung Neurochirurgische Forschung vergeben regelmäßig individuelle Stipendien für Forschungsprojekte oder Studienreisen. Anlässlich der Jahrestagungen der Fachgesellschaft werden weitere Preise für hervorragende wissenschaftliche Beiträge ausgelobt.
Die Autoren danken den zahlreichen Informanten, Interviewpartnern und Stiftern von Nachlässen!
Bildquellen: Wenn nicht anders gekennzeichnet: Archiv für Geschichte der deutschen Neurochirurgie, Würzburg.
Zuletzt geändert am 29-05-2018